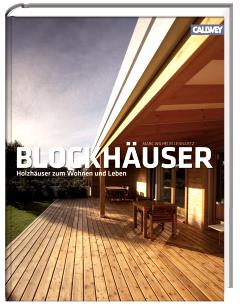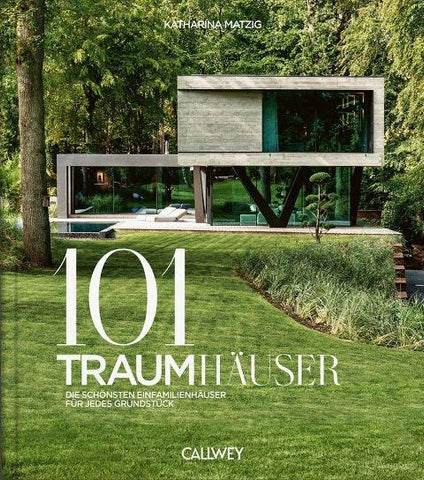Quo vadis? Frage am Kreuzgang auf dem Scheideweg: Wohin gehst du? Welcher Weg ist für mich der bessere? Ist das eher eine praktische oder eine philosophische Frage?
Beim Anblick der gleichen Gänge komme ich ins Grübeln.

- Quo vadis? Wohin gehst du?
- Sollte ich lieber den rechten – also richtigen – Weg einschlagen oder den Weg, auf dem ich einem Menschen begegne?
- Gehe ich an geschlossenen Außentüren vorbei oder wähle ich den Weg durch den Innenhof?
- Was bringt es mir, wenn ich an jeder Ecke das gleiche Bild sehe – Mittelpfeiler, an dem rechts und links zwei Wege abgehen?
- Wie viele Menschen mögen sich diese Fragen in den letzten Jahrhunderten gestellt haben?
Noch mehr über Trier
- Quo vadis? Frage am Kreuzgang auf dem Scheideweg: Wohin gehst du? Welcher Weg ist für mich der bessere? Ist das eher eine praktische oder eine phlilosophische Frage?
- Das Römische Reich ist unter gegangen. Vieles ist übrig geblieben in unserer Sprache. Als Gebäude, als Erfindung als Technik hat es seine Spuren hinterlassen.
- „Untergang des Römischen Reiches“: 3 Museen in Trier zeigen die letzten 200 Jahre des schleichenden Untergangs. Es beginnt mit dem Römischen Reich, das von Schottland über halb Europa bis hin in die heutige Türkei führt. Die Länder rund ums Mittelmeer einschließlich Nordafrika gehören ebenfalls mit dazu. Es endet mit der Plünderung Roms durch die Vandalen.
- Metropolen bis Kleinstädte zeigen kulturinteressierten Besuchern ihre Schätze. Kompetente wie engagierte Berater weisen auf ihre Highlights hin. Auf der Messe für Touristik und Caravan in Stuttgart geht kein Reisewilliger ohne Informationsmaterial heim. ☛ Touristikmesse CMT 2015 – auf der Suche nach Kultur ☛ Touristikmesse CMT 2015 – Kultur in Stadt und Städtchen ☛ Touristikmesse CMT […]