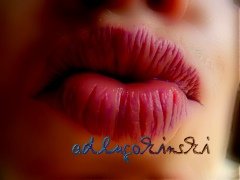✍ Altes Land – 2 Filme im ZDF – passend zum Novemberblues
Wer bis jetzt weder im Novemberblues noch in Herbstdepressionen schwelgt, sollte sich unbedingt „Altes Land“ im ZDF anschauen. Drei Frauen, drei Generationen. Nach dem Bestseller von Dörte Hansen zeigt das ZDF mit einem hochkarätigen Ensemble den Zweiteiler „Altes Land“,