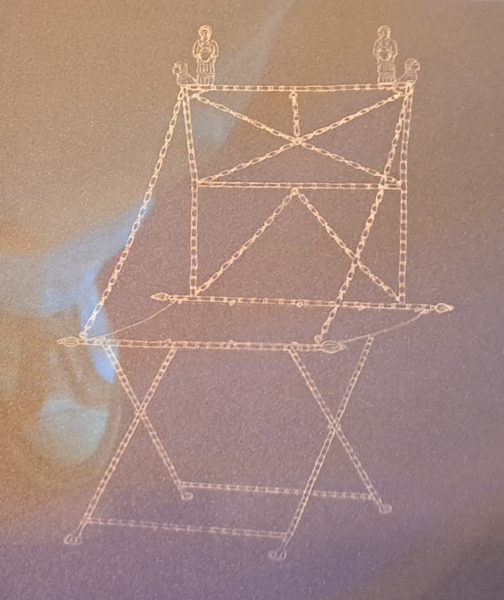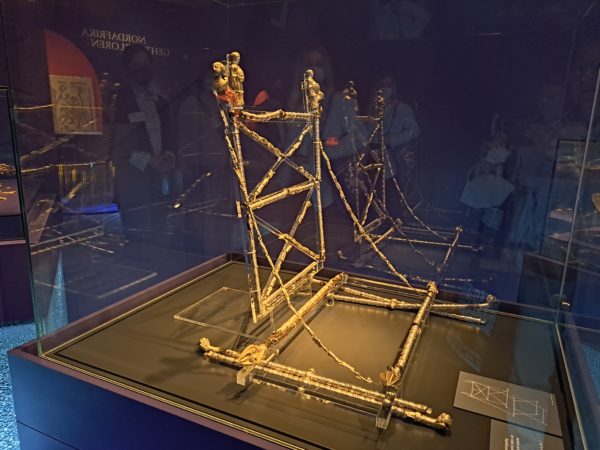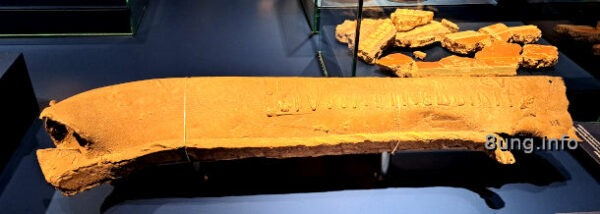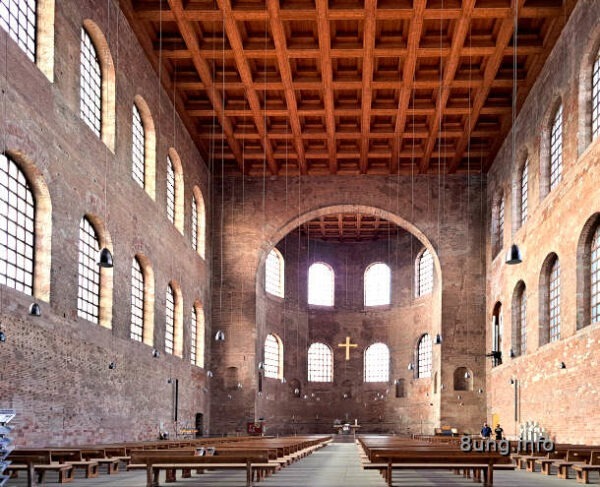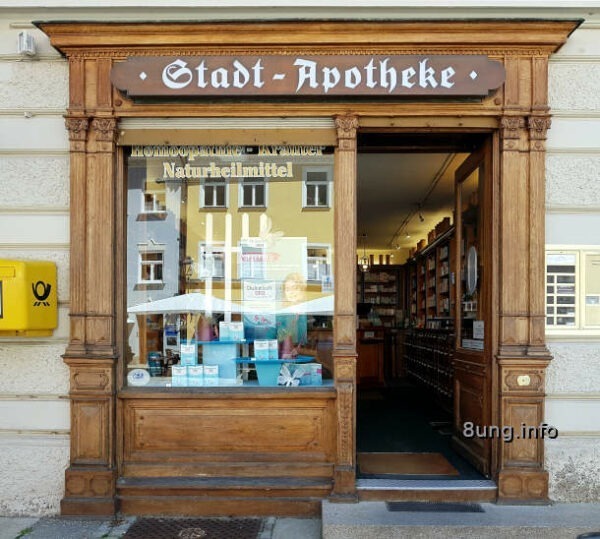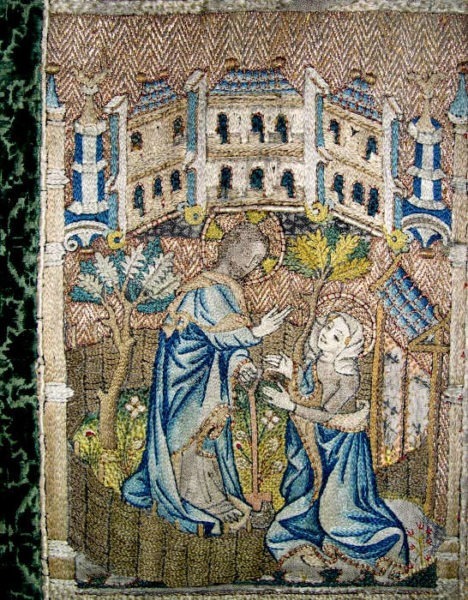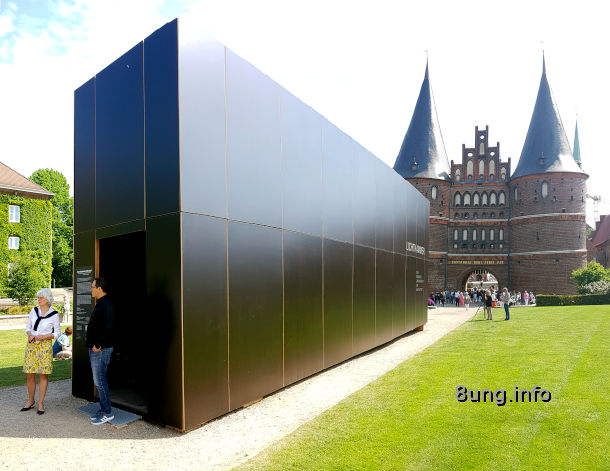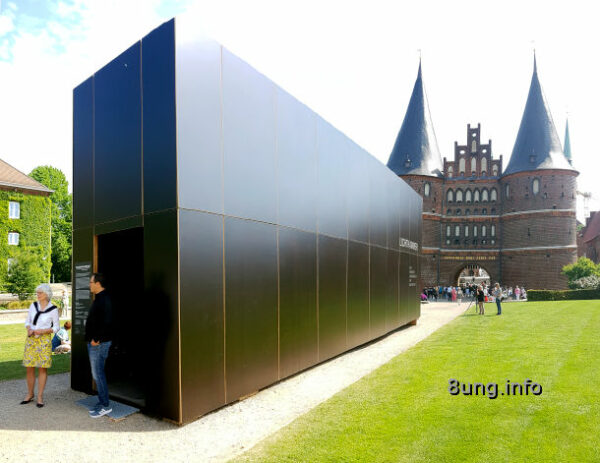Bratislava – eine Stadt, in der die Farben lebendig werden. Von königlichem Blau über zartes Babyblau bis hin zu elegantem Apricot und blendendem Kupfer. Tauchen Sie ein in die bunte Vielfalt der slowakischen Hauptstadt und entdecken Sie ihre faszinierende Geschichte. Ein Kurzbesuch, der die Sonne im Rücken und einzigartige Eindrücke im Herzen hinterlässt![]() .
.
Bratislava in Farbe – Eindrücke vom Kurzbesuch
Kennen sie das? Sie besuchen eine Stadt nur für kurze Zeit. Was bleibt an Eindrücken? In Bratislava bleiben die Farben hängen. Diese Stadt mit ihrer reichen Geschichte, einst Teil Österreichs und sogar Krönungsort von Maria Theresia, hat viele prächtige Gebäude aus vergangenen Zeiten bewahrt. Die Prachtbauten aus dieser Zeit sind bis heute erhalten geblieben und versprühen den Charme der königlichen Herrschaft.
Doch Bratislava wurde auch von kommunistischer Herrschaft beeinflusst. Jetzt ist die Slowakei ein selbstständiger Staat, dessen Bewohner stolz vorwärts schauen.
Die Farben Blau, Weiß und Rot schmücken die slowakische Nationalflagge

Am Wahrzeichen von Bratislava sind die Nationalfarben deutlich erkennbar: Der Himmel erstrahlt in Blau, die dicken Mauern der Burg in Weiß und die Dächer in Rot.

Diese Farben finden sich noch oft in der Stadt selbst wieder. Am neuen Wahrzeichen SND, dem slowakischen Nationaltheater, oder den roten Bussen, die die Touristen durch die Stadt kutschieren.

In allen möglichen Sprachen erhalten die Besucher Informationen über die wechselvolle Geschichte der Stadt.
Gebäude wirken mit den zarten Pastellfarben wie überpudert.

Die „Blaue Kirche“ trägt das helle Blau des Himmels, wenn er von einem zarten Dunst überzogen wird.

Auch im Inneren der Kirche herrscht das Babyblau vor. So zart, dass man sich hineinsetzen und träumen möchte.
Zarte Pastelltöne von Rosa bis Türkis

Zu diesem Babyblau passt ein rosa, dass schon wenige Straßen weiter auf einem Haus prangt. Vom Stil her passt es perfekt in die K-und-K-Zeit, als die Damen sich rosa bepudert haben, bevor sie in die nahe gelegene Oper gingen.

Die Häuser rund um die „Blaue Kirche“ zeigen sich mit vielen Details, wie dieser Rundbogen. Ein Keramikmosaik in hellblau und ocker, verziert mit typischen Jugendstil-Elementen.

Dieser türkise Kirchturm steht an einer strategisch wichtigen Stelle – zumindest für Touristen. Viele kleine Gassen führen zu ihm. Er ist ein dankbares Fotomotiv, schon wegen seiner Farbe. Vom strahlend blauen Himmel hebt er sich besonders gut ab. Wie mag er wohl bei Regenwetter aussehen?
Wenn es absolut keine richtigen Fotomotive gibt, dann ist dieser Kirchturm die Rettung für schnelle Tagestouristen – Klick, und schon ist ein Superfoto im Kasten.

Das Haus in Apricotfarben mit einer Umrahmung von Olivgrün wirkt elegant. Diese Farbkombination passt hervorragend zum Rathausplatz und macht sich gut auf Selfies.

Dagegen funkelt das neue Kupferdach bei Sonnenschein – im wahrsten Sinne des Wortes blendend. Elegant ist wohl der treffendere Ausdruck für dieses Gebäude.
Blassgrau bis strahlend

Doch Bratislava kann auch grau aussehen, zum Beispiel früh morgens an der Donau. Selbst die „alte Brücke“, die bei Sonnenschein in einem soliden Grün erstrahlt, wirkt dann ausgesprochen blass.

Während meines Kurzbesuchs in Bratislava scheint die Sonne. Das macht alles freundlicher. Licht scheint durch Bäume, Sträucher und Menschen.

Der Burg verleiht die Sonne im Rücken einen regelrechten Heiligenschein.
Bratislava, eine Stadt voller Farben
Eine Stadt, die es versteht, ihre Geschichte und ihre Vielfalt in den unterschiedlichsten Tönungen zum Ausdruck zu bringen. Lassen Sie sich von dieser Farbenpracht verzaubern und entdecken Sie die Schönheit dieser Stadt.