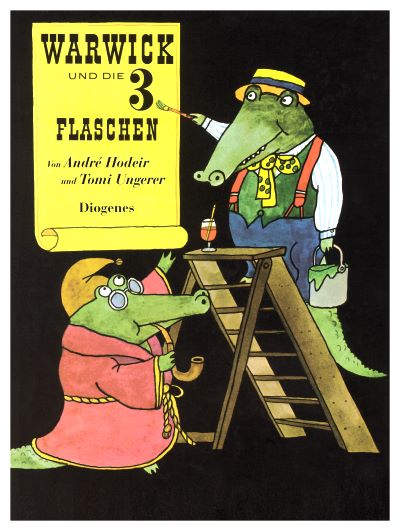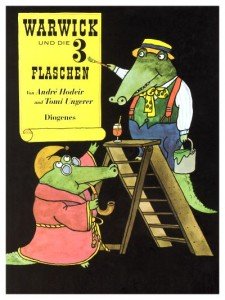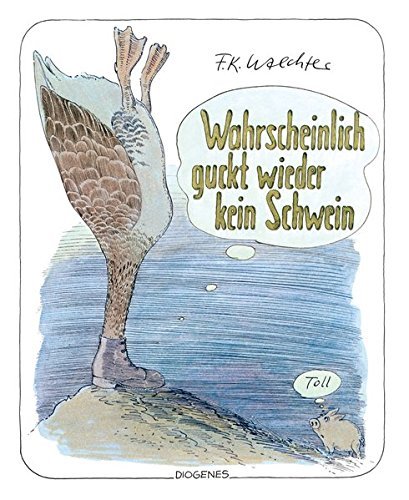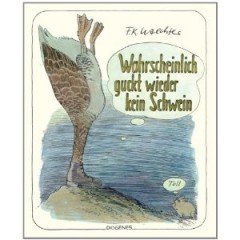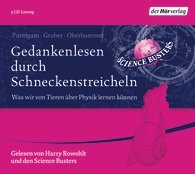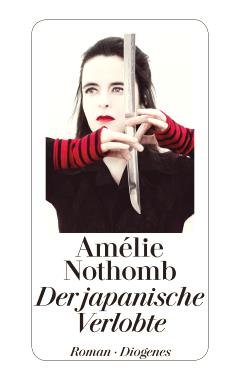Ein
Ein![]() Buch voll hinterhältiger Weihnachtsgeschichten. Es soll Menschen geben, denen das Fest alles vergällt. Wie der polnischen Putzfrau, die extra eine Weihnachtsgans schlachtet, um sie ihrem (wie sie meint) einsamen Arbeitgeber und heimlichen Geliebten mitzubringen.
Buch voll hinterhältiger Weihnachtsgeschichten. Es soll Menschen geben, denen das Fest alles vergällt. Wie der polnischen Putzfrau, die extra eine Weihnachtsgans schlachtet, um sie ihrem (wie sie meint) einsamen Arbeitgeber und heimlichen Geliebten mitzubringen.
Oder, die diesen Rummel nicht mögen wie Peter Ustinov. Er weicht nach Bangkok aus und erlebt, wie ihm und den anderen Gästen zu Ehren von den Einheimischen Weihnachtslieder vorgesungen werden. Es gibt aber auch Menschen, die Weihnachten so sehr mögen, dass sie damit ihre Umwelt im Sommer in Weihnachtsstimmung versetzen können – wie der alte Schauspieler, dem lediglich der Schnee fehlte. Zum Glück war das nicht sein Problem, sondern auf Versagen der Regie zurückzuführen.
Wenn die einen feiern, bedeutet es für die andern meist Arbeit. Richtig anstrengend kann das für den Weihnachtsmann werden. Er hat mit seinen Ermahnungen die verpatzte Erziehungsarbeit der letzten 364 Tage nachzuholen. Meist bekommt er dafür ein Trinkgeld (von den Vätern). Nur einmal wollte eine Mutter noch zusätzlich Sex, was er dankend ablehnte, aber ihrem Mann eine gutaussehende Sekretärin wünschte. Nachdem er sich 14 x „Liebaguta Weihnaksmann, schaumirnich so böse an“ gehört hatte, war er nicht einmal mehr in der Lage, mit den anderen Weihnachtsmännern dieser Agentur anzustoßen.
Richtig anstrengend kann Weihnachten aber auch für das Gewohnheitstier sein, das Georg Kreisler in Versform beschreibt. Wenn einer jeden Tag seinen Ablauf vom Aufstehen bis zum Schlafengehen klar nach der Uhr regelt, seine Wochentage genau unter seinen Vereinen und seiner Geliebten aufteilt, mehrmals im Jahr feste Termine in geraden und ungeraden Monaten wahrnimmt, für den kommt Weihnachten äußerst ungelegen, denn Weihnachten bringt den ganzen schönen Plan durcheinander.
Zu Weihnachten brachte in den Fünfzigern gar eine Bemerkung eine ganze Siedlung im Ruhrgebiet in Aufruhr. Der blöden Erika entfuhr – weil sie nur prahlen wollte – dass ihr Onkel einen Fernseher besitzt. Das war in der Siedlung vollkommen neu. Als Vertrauensbruch wurde gewertet, dass er die Siedlung nicht teilhaben ließ – etwa durch Einladungen zu Weihnachten. Ein Siedler nach dem Anderen wurde unter einem Vorwand zu ihm geschickt. Als keiner mehr zurückkam – weil sie alle vor dem Fernseher saßen – setzte die Völkerwanderung ein. Das war zu viel für das kleine Wohnzimmer des Witwers, in dem sich alle vor dem Wunderapparat drängten. Nachdem die Wohnung mit dem umgekippten Weihnachtsbaum in Brand gesteckt und durch nachfolgende Löscharbeiten verwüstet wurde, zogen sie ab und kauften sich im Laufe der Jahre selbst so einen Kasten. Bloß der alte Witwer blieb bis ans Ende seines Lebens fernsehlos.
Lauter hinterhältige Weihnachtsgeschichten, in Prosa und in Versform, sind in diesem Buch zusammengetragen. Neben den Gerne-Weihnachten-Feiernden gab es schon immer regelrechte Weihnachten-Verächter, wie Heinrich Heine (*1797) beweist. Zumindest regt dieses Buch zum Schmunzeln an, oder zum Nachdenken. Vielleicht ist es in der hektischen Zeit ein ruhender Pol zum Selbstlesen geeignet – besser noch, zum Vorlesen in Gesellschaft.
Früher war Weihnachten viel später: Hinterhältige Weihnachtsgeschichten | Diogenes;
Fehler: A feed could not be found at `https://www.8ung.info/tag/weihnachten/feed/`; the status code is `403` and content-type is `text/html; charset=iso-8859-1`