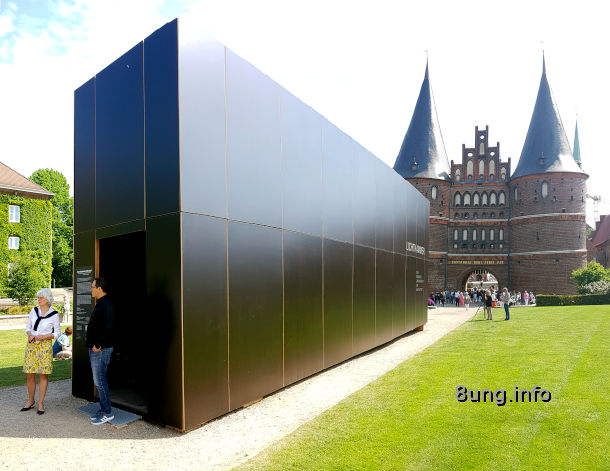☛ Museum Trier: Untergang des Römischen Reiches – wer ist schuld?
„Untergang des Römischen Reiches“: 3 Museen in Trier zeigen die letzten 200 Jahre des schleichenden Untergangs. Es beginnt mit dem Römischen Reich, das von Schottland über halb Europa bis hin in die heutige Türkei führt. Die Länder rund ums Mittelmeer einschließlich Nordafrika gehören ebenfalls mit dazu. Es endet mit der Plünderung Roms durch die Vandalen.