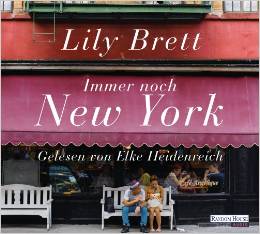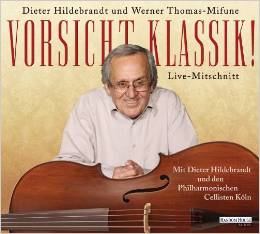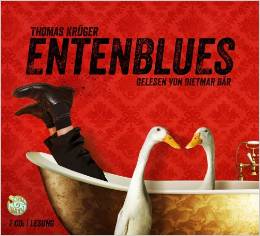Armer Mann, was nun? Überlebenskampf eines Familienvaters um die Vierzig zwischen Stammtisch, Selbstfindungsseminar, Imponiergehabe und Söhne vom Kindergarten abholen.
Da staunt frau, was Männer in den Wechseljahren zu bieten haben
Er ist einfach zum Knuddeln, der Mann um die Vierzig. Voller Selbstzweifel, fühlt sich alt und abgewrackt, versucht aber – ganz alter Kater – den jungen Frauen zu imponieren. Leider geht der Versuch in die Hose, vor dem Friseurladen seiner Angehimmelten einen Schnellstart im Jogginganzug hinzulegen.
ist einfach zum Knuddeln, der Mann um die Vierzig. Voller Selbstzweifel, fühlt sich alt und abgewrackt, versucht aber – ganz alter Kater – den jungen Frauen zu imponieren. Leider geht der Versuch in die Hose, vor dem Friseurladen seiner Angehimmelten einen Schnellstart im Jogginganzug hinzulegen.