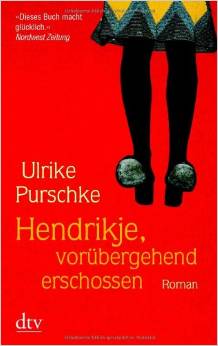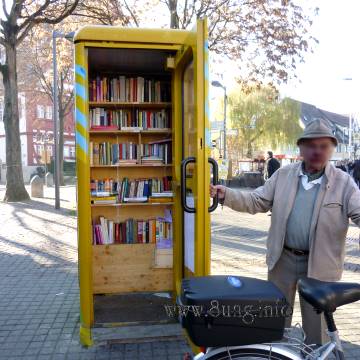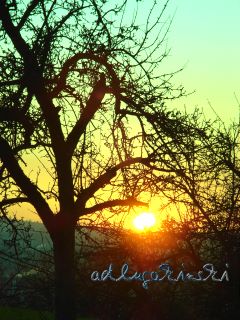Schauspiel nach dem Roman von Karl Philipp Moritz im Depot in Stuttgart
im Depot in Stuttgart
 Können Sie sich noch erinnern?
Können Sie sich noch erinnern?
Es muss so in den Siebzigern gewesen sein, als alle Männer plötzlich in ihrer zwölften Pubertät steckten, ihre Analphase nicht ordnungsgemäß hinter sich gebracht hatten oder ständig Misserfolgserlebnisse mit Frauen vorweisen konnten, weil sie von Müttern, Großmüttern, Tanten und so weiter in ihrer frühkindlichen Identifizierungsphase falsch behandelt oder gar abgelehnt wurden.
All diese Männer hatten schon einen Vorgänger – lange vor Freud: